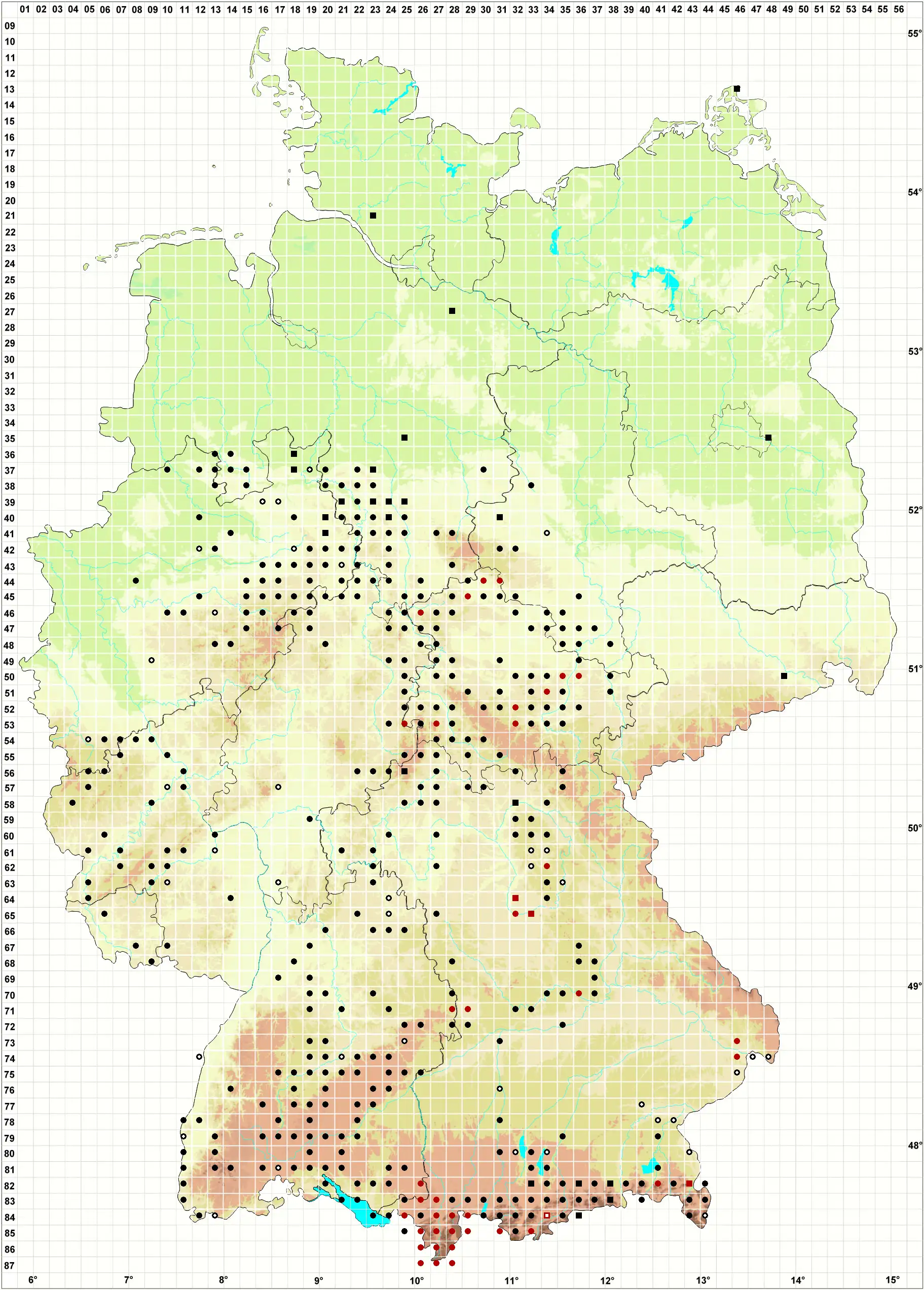Trichostomum crispulum Bruch
Sammelkarte aus den Arten:
- Trichostomum crispulum Bruch
- Trichostomum crispulum Bruch var. crispulum
- Trichostomum crispulum var. viridulum (Bruch) Dixon
Flora 12: 395. 1829
Deutscher Name: Krauses Haarmundmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Trichostomum
Synonyme: Trichostomum brevifolium Sendtn. ex Müll.Hal., Trichostomum crispulum var. angustifolium Bruch & Schimp., Trichostomum crispulum var. brevifolium (Müll.Hal.) Bruch & Schimp., Trichostomum crispulum var. elatum Schimp., Trichostomum hammerschmidii Loeske & H.K.G.Paul, Trichostomum planum Lindb.
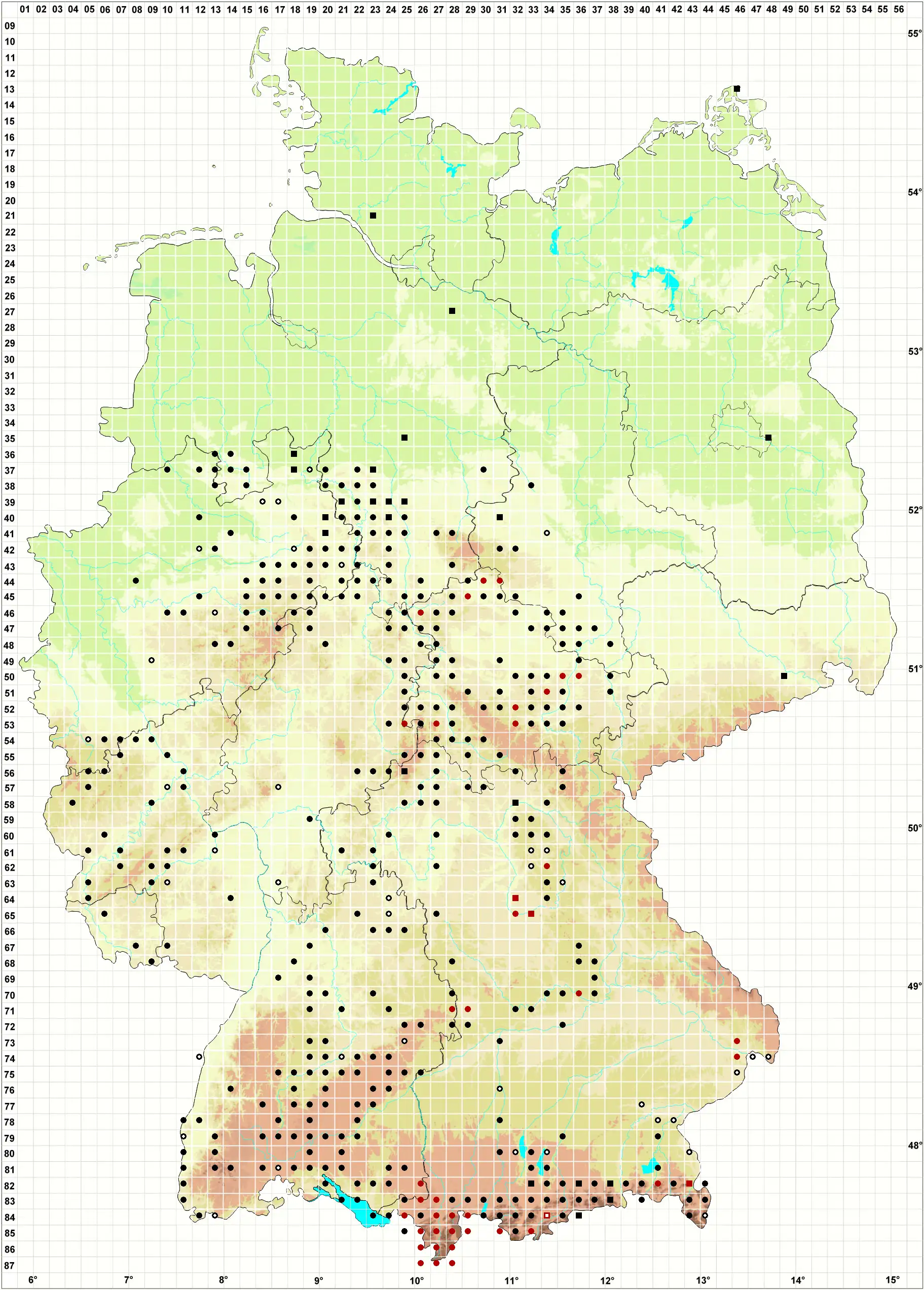
In unserer Datenbank gibt es 810 Datensätze .
Bitte wechseln Sie zu einem Bundesland, um detailliertere Darstellungen für einzelne Fundstellen einzusehen oder eine genauere Karte zur Weiterverwendung zu beziehen.
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): *
- Bayern (2019): *
- bya: *
- byk: *
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Trichostomum affine Schleich. ex F.Weber & D.Mohr
- → Trichostomum aquaticum Brid. ex Schrad.
- → Trichostomum bambergeri Schimp.
- → Trichostomum brachydontium Bruch
- → Trichostomum brachydontium Bruch var. brachydontium
- → Trichostomum brachydontium subsp. cuspidatum (Braithw.) Giacom.
- → Trichostomum brachydontium var. cuspidatum (Braithw.) L.I.Savicz
- → Trichostomum brevifolium Sendtn. ex Müll.Hal.
- → Trichostomum caespitosum (Brid.) Jur.
- → Trichostomum canescens Timm ex Hedw.
- → Trichostomum conicum Hampe
- → Trichostomum crispulum Bruch var. crispulum
- → Trichostomum crispulum var. angustifolium Bruch & Schimp.
- → Trichostomum crispulum var. brevifolium (Müll.Hal.) Bruch & Schimp.
- → Trichostomum crispulum var. elatum Schimp.
- → Trichostomum crispulum var. viridulum (Bruch) Dixon
- → Trichostomum cylindricum (Brid.) Müll.Hal.
- → Trichostomum cylindricum Hedw.
- → Trichostomum decipiens Schultz
- → Trichostomum ericoides F.Weber ex Brid.
- → Trichostomum fasciculare Hedw.
- → Trichostomum flavovirens Bruch
- → Trichostomum fontinaloides Hedw.
- → Trichostomum funale Schwägr.
- → Trichostomum glaucescens Hedw.
- → Trichostomum guestphalicum Müll.Hal.
- → Trichostomum hammerschmidii Loeske & H.K.G.Paul
- → Trichostomum heterostichum Hedw. ex Hedw.
- → Trichostomum inclinatum (R.Hedw.) Dixon
- → Trichostomum inflexum Bruch
- → Trichostomum lanuginosum Hedw.
- → Trichostomum laureri Schultz
- → Trichostomum microcarpon Hedw.
- → Trichostomum mutabile Bruch
- → Trichostomum mutabile var. cuspidatum (Braithw.) Limpr.
- → Trichostomum obtusum Retz. ex Brid.
- → Trichostomum pallidisetum H.Müll.
- → Trichostomum pallidum Hedw.
- → Trichostomum planum Lindb.
- → Trichostomum pulvinatum var. alpestre Schleich. ex F.Weber & D.Mohr
- → Trichostomum sinuosum (Mitt.) Müll.Hal.
- → Trichostomum sudeticum Funck
- → Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb.
- → Trichostomum tenuirostre var. holtii (Braithw.) Dixon
- → Trichostomum tophaceum Brid.
- → Trichostomum tortuosum (Hedw.) Dixon
- → Trichostomum triumphans De Not.
- → Trichostomum vaginans Sull.
- → Trichostomum viridulum Bruch