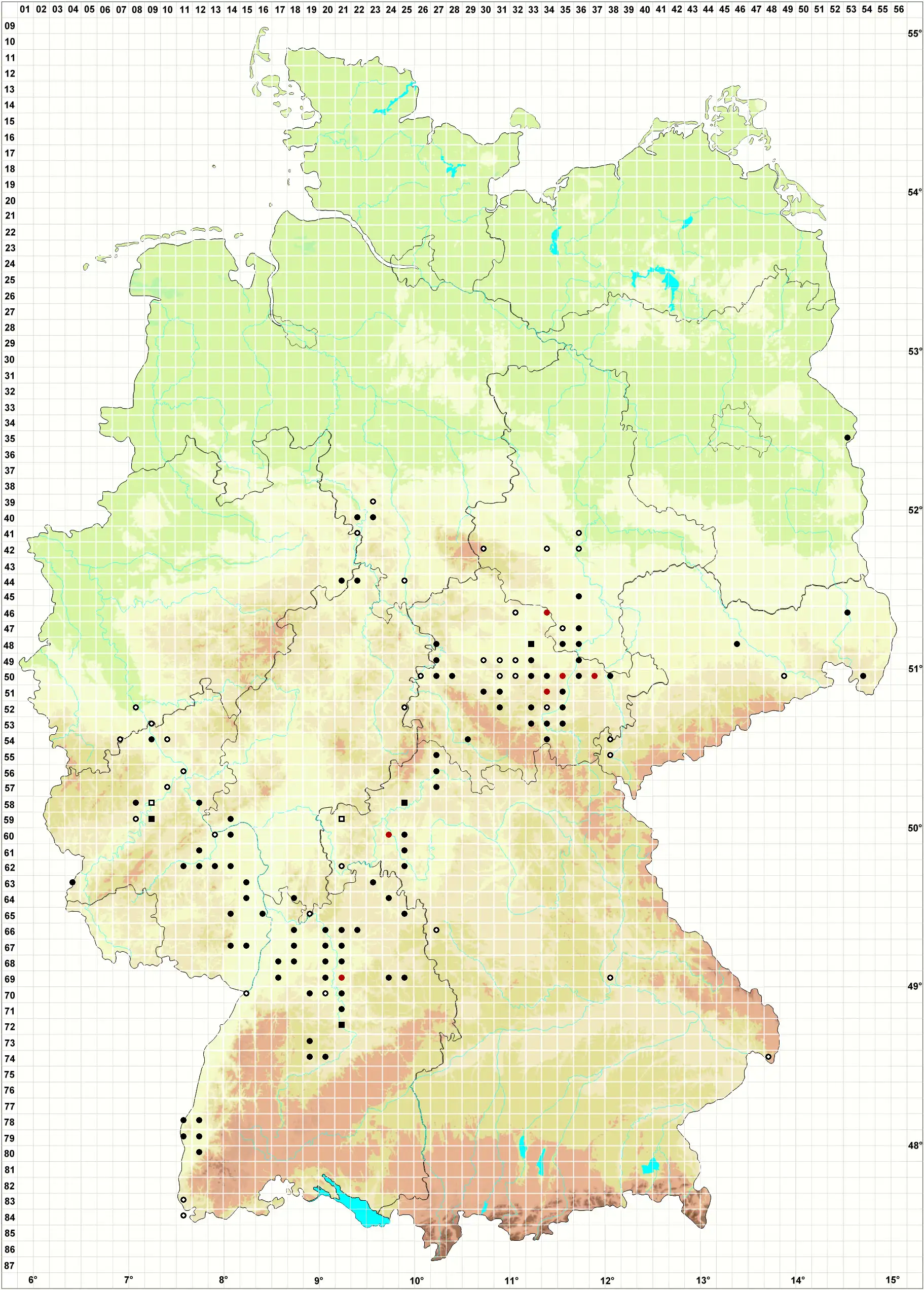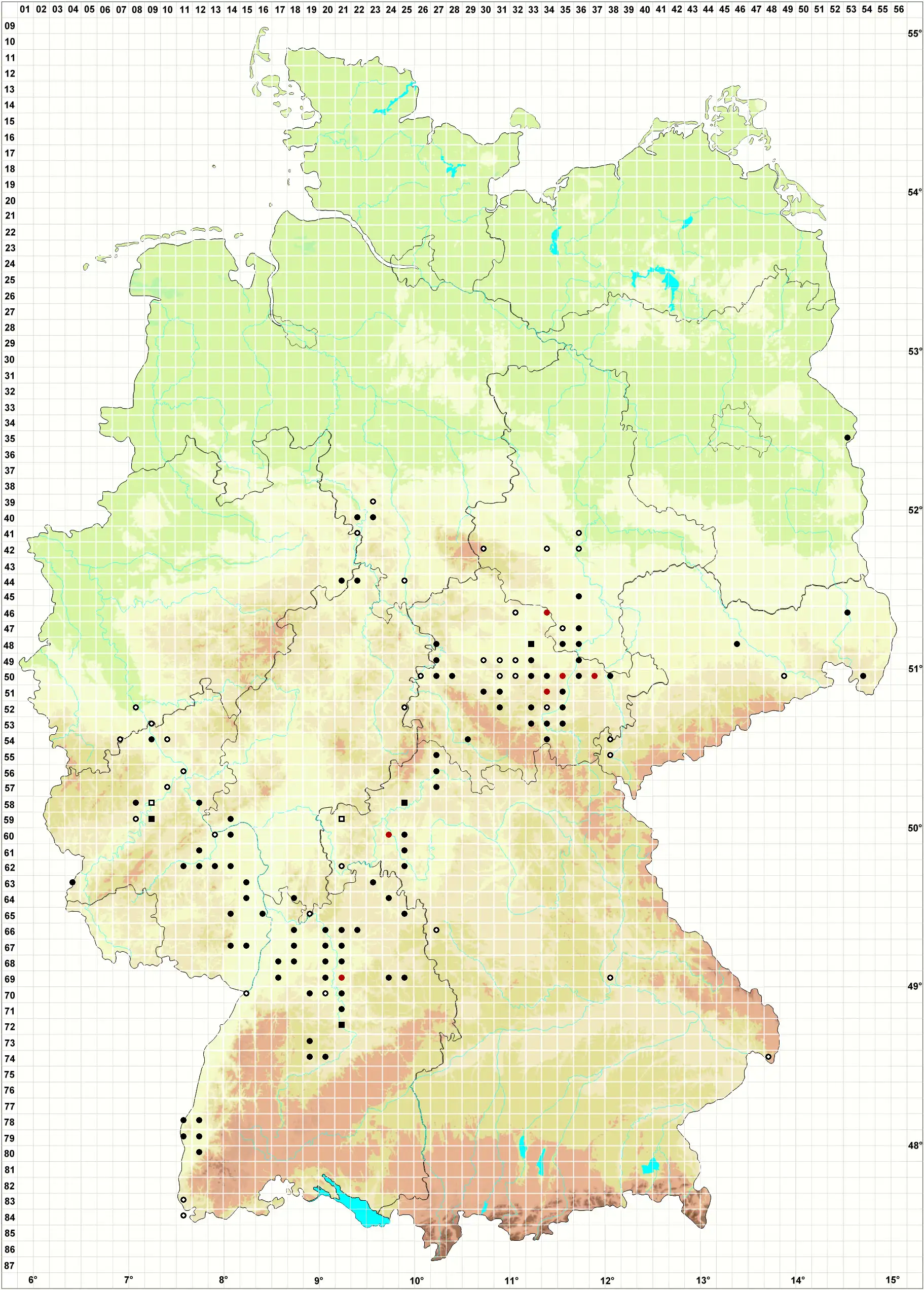
In unserer Datenbank gibt es 195 Datensätze .
Bitte wechseln Sie zu einem Bundesland, um detailliertere Darstellungen für einzelne Fundstellen einzusehen oder eine genauere Karte zur Weiterverwendung zu beziehen.
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- bya: -
- Deutschland (2018): 3
- Bayern (2019): R
- byk: R
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Didymodon acutus (Brid.) K.Saito
- → Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson
- → Didymodon australasiae var. umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander
- → Didymodon austriacus Schiffn. & Baumgartner
- → Didymodon barbuloides Lib. ex Marchal
- → Didymodon bosniacus Głow.
- → Didymodon crenulatus Mitt.
- → Didymodon cylindricus var. daldinianus De Not.
- → Didymodon erosus J.A.Jiménez & J.Guerra
- → Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander
- → Didymodon fallax var. brevifolius (With.) Ochyra
- → Didymodon fallax var. fallax
- → Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill
- → Didymodon ferrugineus var. kneuckeri (Loeske & Osterwald) Düll
- → Didymodon flexicaulis var. sterilis De Not.
- → Didymodon fragilis Drumm.
- → Didymodon gemmascens Mitt. ex Hunt
- → Didymodon giganteus (Funck) Jur.
- → Didymodon glaucus Ryan
- → Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) K.Saito
- → Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill
- → Didymodon jenneri Schimp.
- → Didymodon linearis Sw.
- → Didymodon luridus Hornsch.
- → Didymodon mamillosus (Crundw.) M.O.Hill
- → Didymodon nicholsonii Culm.
- → Didymodon pusillus Hedw.
- → Didymodon rigidicaulis (Müll.Hal.) K.Saito
- → Didymodon rigidulus Hedw.
- → Didymodon rigidulus Hedw. var. rigidulus
- → Didymodon rigidulus subsp. andreaeoides (Limpr.) Wijk & Margad.
- → Didymodon rigidulus var. glaucus (Ryan) Wijk & Margad.
- → Didymodon rigidulus var. validus (Limpr.) Düll
- → Didymodon ruber Jur. ex Geh.
- → Didymodon rufus Lorentz
- → Didymodon sicculus M.J.Cano, Ros, Garcia-Zam. & J.Guerra
- → Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne
- → Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.
- → Didymodon spadiceus var. siluricus Velen.
- → Didymodon spitsbergensis Dixon ex E.W.Jones
- → Didymodon subandreaeoides (Kindb.) R.H.Zander
- → Didymodon tomaculosus (Blockeel) M.F.V.Corley
- → Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
- → Didymodon trifarius auct. non (Hedw.) Röhl.
- → Didymodon trivialis (Müll.Hal.) J.Guerra
- → Didymodon umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander
- → Didymodon validus Limpr.
- → Didymodon verbanus (W.E.Nicholson & Dixon) Loeske
- → Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander
- → Didymodon vinealis var. flaccidus (Bruch & Schimp.) R.H.Zander
- → Didymodon zetterstedtii Schimp.